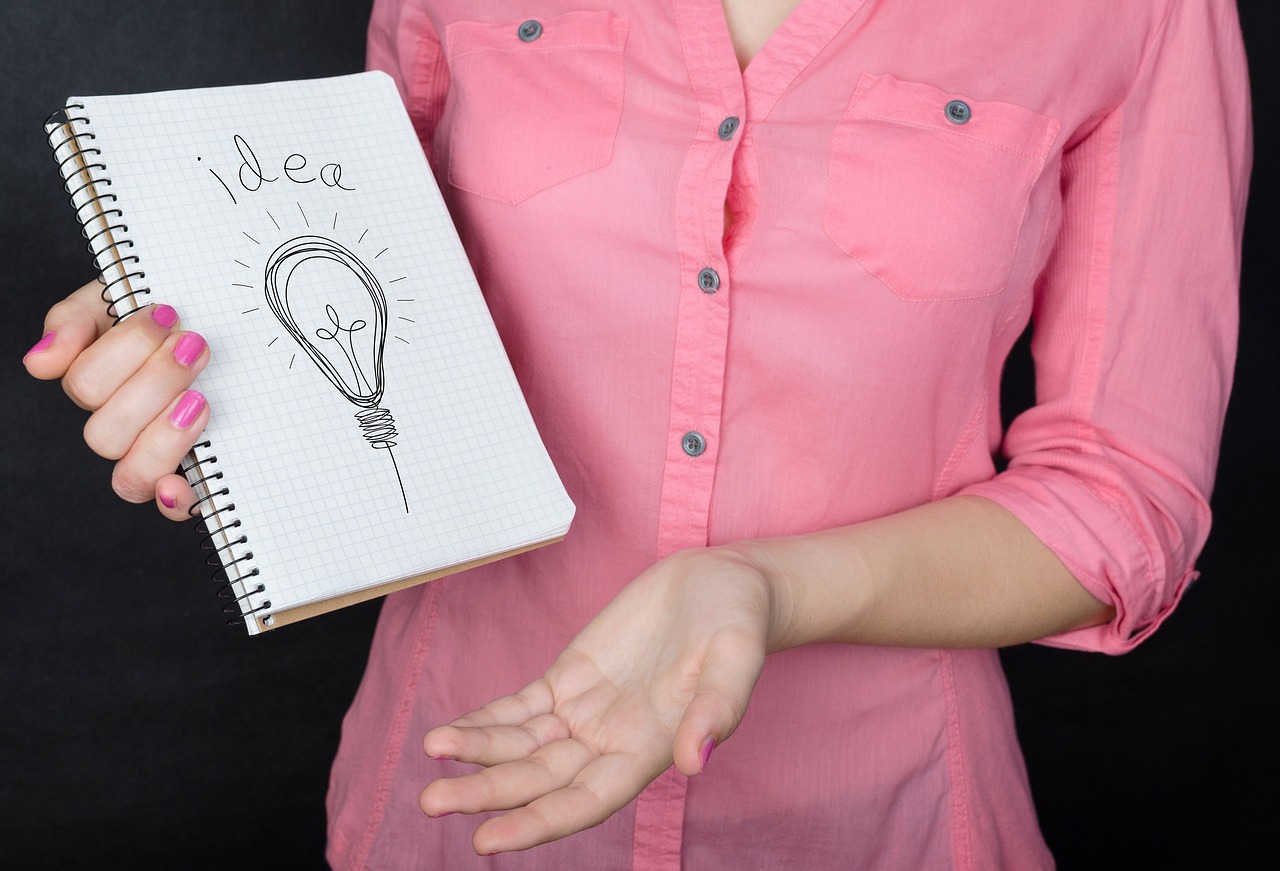Kontroverse um Gewinner des Goncourt-Preises inmitten juristischer Auseinandersetzungen
Kamel Daoud, der kürzlich für seinen Roman Houris den renommierten französischen Goncourt-Preis erhielt, sieht sich in Algerien mit rechtlichen Problemen konfrontiert. Das Buch, das sich mit den traumatischen Erfahrungen des algerischen Bürgerkriegs in den 1990er Jahren befasst – der schätzungsweise 200.000 Todesopfer forderte – hat eine heftige Debatte über Autorschaft und ethisches Geschichtenerzählen ausgelöst.
Vorwürfe eines Überlebenden
Saada Arbane, die einen islamistischen Angriff überlebt hat, der ihre Familie zerstörte, behauptet, dass Houris stark aus ihrer persönlichen Geschichte schöpft. Im algerischen Fernsehen brachte sie ihre Verzweiflung zum Ausdruck und behauptete, dass die Figur Fajr ihre eigene Lebensgeschichte widerspiegelt. Arbane, die aufgrund ihrer Verletzungen über ein Sprachrohr kommuniziert, besteht darauf, dass viele Details über Fajr – wie ihre körperlichen Narben und intimen Beziehungen – während der Therapiesitzungen mit Daouds Frau Aicha Dahdouh besprochen wurden.
Arbane behauptet, sie habe Daoud drei Jahre vor der Veröffentlichung des Buches ausdrücklich die Erlaubnis verweigert, ihre Geschichte zu verwenden. Sie äußerte ihre tiefe Bestürzung darüber, dass sie sich an den Rand gedrängt fühlte: „Es ist mein Leben. Es ist meine Vergangenheit. Er hatte kein Recht, mich so rauszuwerfen.“
In Algerien sind zwei Gerichtsverfahren gegen Daoud und Dahdouh anhängig. Eine Klage dreht sich um Verstöße gegen die ärztliche Schweigepflicht, während sich die andere auf ein Gesetz beruft, das die Ausbeutung nationaler Tragödien zu literarischen Zwecken verbietet. Dieses Gesetz hat dazu geführt, dass Huris in Algerien verboten wurden und die öffentliche Debatte über den Bürgerkrieg eingeschränkt wurde.
Kulturelle und politische Implikationen
Daouds Sieg ist in Algerien nicht unumstritten. Dort wurde er für seine vermeintliche Nähe zu französischen Literaturkreisen kritisiert, nachdem er 2020 nach Paris umgezogen war. Sein vorheriges Werk „Die Ermittlungen von Meursault“ erntete zwar Anerkennung, konnte die Kritik an seinem derzeitigen Ansehen jedoch kaum beschwichtigen.
Antoine Gallimard, Daouds Verleger, nahm ihn gegen die Vorwürfe der Verleumdung in Schutz und betonte, dass die Geschichte zwar von wahren Begebenheiten in Algerien inspiriert sein könnte, die Charaktere jedoch völlig fiktiv seien.
Der Zeitpunkt dieses Rechtsstreits ist angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen Algerien und Frankreich besonders bedeutsam. Die jüngsten Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, der die marokkanische Souveränität über die Westsahara anerkannte, haben die Beziehungen weiter belastet. Viele Algerier betrachten Daouds Auszeichnung eher als politisch motiviert denn als Anerkennung künstlerischer Verdienste.
Angesichts dieser Ereignisse bleibt die Situation für Schriftsteller wie Boualel Sansal, der kurz nach seiner Rückkehr nach Algerien unter verdächtigen Umständen verschwand, weiterhin prekär. Diese Entwicklung wirft alarmierende Fragen hinsichtlich der Meinungsfreiheit für regierungskritische Künstler auf.
Diese Kontroversen werfen ein Schlaglicht auf einen größeren Streit um narrative Eigentumsrechte und die Implikationen des Geschichtenerzählens in postkolonialen Kontexten. Die Schnittstelle zwischen Kunst und Politik bleibt weiterhin voller Komplexitäten, da beide Nationen mit ihrem historischen Erbe zu kämpfen haben.